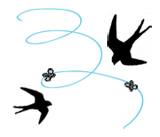Die deutsche Chemieindustrie ist mit über 190 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2015 die größte in Europa. BASF und Bayer gehören zu den fünf weltgrößten Herstellern von Agrarchemikalien. Die Branche weiß ihre Interessen in Brüssel und Berlin zu vertreten. Der „European Chemical Industry Council“, ihr europäischer Spitzenverband, gibt mit Abstand das meiste Geld für Lobbytätigkeit in Brüssel aus. Im Jahr 2015 waren es 10,2 Millionen Euro. Die Verbandsfunktionäre und -funktionärinnen hatten 37 Treffen mit der EU-Kommission und verfügten über 25 Zugangspässe, die einen Aufenthalt im Europäischen Parlament ohne Einladung und Voranmeldung ermöglichen. Zum Vergleich: Die nach ihnen aktivste Lobbyorganisation, die vereinigten Industrie- und Handelskammern, gaben 2015 rund 7,6 Millionen Euro aus, trafen sich 33-mal mit hohen Kommissionsbeamten und -beamtinnen und kamen auf elf Zugangspässe für das Europäische Parlament.
Bei den Verhandlungen um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP überraschte das Ausmaß der Lobbytätigkeit selbst die Fachleute des Corporate Europe Observatory. Die Anti-Lobby-Organisation veröffentlichte die genaue Analyse der Kontakte mit der EU-Kommission in den TTIP-Vorverhandlungen. Daraus geht hervor, dass die Agrarchemie- und Biotechindustrie mehr Kontakte mit der EU-Handelskommission hatte als die Lobbyisten und Lobbyistinnen der Pharma- und Autoindustrie und des Finanzsektors zusammen.
Auch in Deutschland wirkt der Einfluss der Industrie in die Büros der Bundesbehörden. Der Interessenskonflikt scheint hier die Regel. Beim Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin ist ein Expertengremium für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel angesiedelt. Zehn der zunächst vierzehn, nun zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiteten auch für die Industrie. Obwohl dieser Missstand seit 2012 bekannt ist, haben nur vier Expertinnen und Experten das Gremium verlassen. Auch die gesetzlich vorgeschriebene Offenlegung ihrer Industrietätigkeit war unvollständig, weil die Expertinnen und Experten nicht alle ihre Jobs bei biotechnischen Firmen angaben.
Wie wirkt sich dieser Interessenkonflikt auf Entscheidungen aus? Inzwischen ist es bereits in die USA vorgedrungen, wie industriefreundlich das Expertengremium des BfR entscheidet. So wurde die neue Methode der Genschere (CRISPR/Cas9) nicht als Gentechnik klassifiziert. Pflanzen mit manipulierten CRISPR/Cas9-Genen können daher einfach zugelassen werden, besonders dann, wenn sie auch durch konventionelle Züchtung hätten entstehen können. Dabei sind Gefahren und Auswirkungen dieser neuen Gentechnikverfahren wegen mangelnder Grundlagenforschung kaum bekannt. Auch schneidet die Genschere nicht so genau, wie von der Industrie behauptet werde, sagen Kritiker: Die Fehlerquote liege bei 25 Prozent.
Die meisten Rechtsgutachten widersprechen der Einschätzung des BfR, dieses „Genome Editing“ sei rechtlich nicht als gentechnisches Verfahren mit entsprechenden Nachweis- und Kennzeichnungspflichten zu verstehen. Frankreich will das vom Europäischen Gerichtshof klären lassen, während Schweden und Argentinien die laxe Haltung der Deutschen übernommen haben; das Bundeskabinett folgt der Einschätzung des BfR-Expertengremiums. Eine 2016 im Bundestag eingebrachte Novelle des Gentechnikgesetzes entspricht weitgehend dem Wunsch der Industrie, die neuen Technologien unkompliziert zuzulassen. In letzter Minute wurde eine weitreichende Passage geändert: Nun kann die Bundesregierung von Fall zu Fall selbst entscheiden, ob sie solche per „Genome Editing“ programmierten CRISPR-Pflanzen entweder nach dem „Vorsorgeprinzip“ mit Zulassungsverfahren und Risikobewertung oder nach dem „Innovationsprinzip“ ohne viele weitere Formalitäten freigibt. Das Innovationsprinzip bewertet die Auswirkungen auf ein gutes Innovationsklima in Deutschland, eine Forderung insbesondere des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI).
Die Hersteller der Pestizide – also die Antragsteller – dürfen bei der Zulassung eines neuen Pestizids selber entscheiden, in welchem EU-Land die Prüfung stattfinden soll. Deswegen fiel wohl auch die Entscheidung auf Deutschland, als es um die wichtigste EU-Wiederzulassung der letzten Jahre ging: die von Glyphosat. Wenn die Industrie ein Zulassungsverfahren für Pestizide in der EU startet, bestimmt sie selbst die Vorauswahl der wissenschaftlichen Studien dafür. Diese Aufgabe übernahm die „Glyphosate Task Force“ (GTF), ein Zusammenschluss der Glyphosathersteller unter der Federführung des Saatgutkonzerns Monsanto.
Betreut wird die GTF von der Kommunikationsagentur Genius. Sie wiederum arbeitet als Gutachter für Bundeseinrichtungen, etwa für das Büro für Technikfolgen-Abschätzung (TAB) beim Bundestag oder für das Umweltbundesamt. Aber sie ist auch als PR-Agentur für die Gen- und Biotechnologie-Industrie tätig. So leitet ein Seniorberater von Genius eine Arbeitsgruppe von BIO Deutschland, dem Lobbyverband der deutschen Gen- und Biotechindustrie. Diese Arbeitsgruppe versammelt die mehr als 40 Pressestellen der beteiligten Unternehmen, um gemeinsam „das Bild der Biotechnologie in der Öffentlichkeit zu verbessern“, wie es auf ihrer Website heißt.
Bei der Glyphosat-Risikobewertung des BfR wurden alle unabhängigen Untersuchungen, die von öffentlichen Institutionen und ohne Industriegelder durchgeführt wurden, von der Evaluierung ausgeschlossen; keine einzige wurde als Studie betrachtet. Wie sehr wiederum die Bewertungen von Studien voneinander abweichen können, wurde deutlich, als die Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Glyphosat als „wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen“ einstufte. Die Öffentlichkeit und die Fachwelt hinterfragten die Einschätzung der Risikobewertung in Deutschland. Denn im Gegensatz zum BfR nutzt die WHO öffentlich geförderte Studien, und sie besteht auf dem Zugang zu den Rohdaten der Studien, um die Ergebnisse zu überprüfen.
Für mehr Transparenz bei der Zulassung von Glyphosat hat der Europäische Gerichtshof im November 2016 gesorgt. Er urteilte, gespritzte Agrarchemie sei als Emission zu betrachten. Damit unterliege auch deren Zulassung strengeren Transparenzvorschriften als zuvor. Der Zugang zu bisher verschlossenen „Grauen Studien“ wird nun auch für unabhängige Stellen möglich.
Quelle: TAZ (Aus Le Monde diplomatique), 30.12.16
https://www.taz.de/Aus-Le-Monde-diplomatique/!5369648/
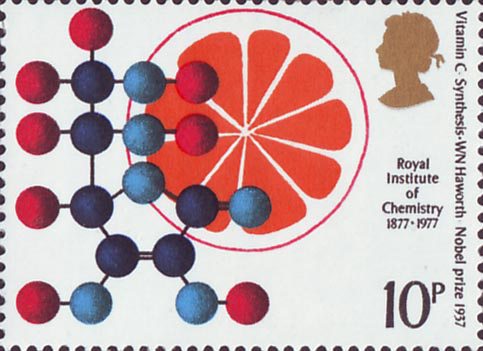
- Login om te reageren